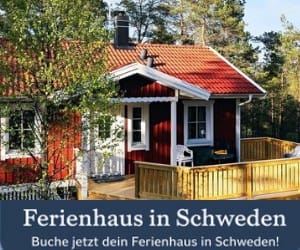Nach den ersten fehlgeschlagenen Christianisierungsversuchen durch Ansgar im 9. Jahrhundert sollte es noch rund 150 Jahre dauern, bis die Missionsarbeit im Reich der Svear und Götar Früchte trug. Zur Jahrtausendwende findet in Schweden auch eine Wendung zur christlichen Lehre hin statt. Vertrieben sind die alten Götter noch nicht.
Aktive Christianisierung zur Jahrtausendwende
Einen wichtigen Wendepunkt erfährt die Christianisierung Schwedens um das Jahr 1000. Münzfunde aus Sigtuna zeigen Olov Eriksson, besser bekannt als Olov Skötkonnung, als christlichen König. Olov ließ sich etwa 1008 taufen, zeitgleich mit dem Zusammenschluss der Herrschaftsgebiete der Götar und Svear. Anders als sein Vater, der sich zwar taufen ließ, aber bald vom neuen Glauben abfiel, war Olov der erste schwedische König, der aktiv die Christianisierung betrieb und somit der christlichen Mission zum Durchbruch verhalf.
In Skara, nicht weit von Olvos Taufort Husaby, wurde der erste Bischofssitz Schwedens eingerichtet. Ein weiterer kam unter König Stenkils (1060-66) in Sigtuna hinzu.
Fortschreitende Christianisierung 11. Jahrhundert
Im 11. Jahrhundert wird die Missionsarbeit in den schwedischen Landschaften fortgesetzt, ausgehend von England und den südlichen Nachbarn. Wobei englische Missionare und das Erzbistum Hamburg in Konkurrenz zueinanderstanden – die Glaubensfrage war auch eine Machtfrage. Zu den wenigen bekannten Missionaren, jener Tage gehören beispielsweise David, Botvid, Sigfrid und Eskil, der Namensgeber der Stadt Eskilstuna. Allemiteinander stiegen schon bald in den Heiligenstatus auf.

Im Zuge der weiteren Missionierung folgten Reichsadel und politische Führung dem Beispiel Olovs Skötkonnung.
Anzeichen der Christianisierung Schwedens
Die voranschreitende Christianisierung Schwedens lässt sich an der Vermehrung christlicher Symbole ablesen. So finden sich zunehmend auf Runensteinen Kreuze und Gebetsinschriften, wobei Runensteine Angelegenheit der Mächtigen waren. Christliche Symbolik greift auch in Form von Amuletten, um den Hals oder am Handgelenk getragen, um sich.
Runensteine wie Amulette zeigen aber auch die nach wie vor vorhandene Abwehrhaltung gegenüber der neuen Religion. Abbildungen „heidnischer“ Glaubenssymbole, etwa des Thorshammers, waren in früheren Zeiten nicht üblich, sondern kamen erst im Zuge der Christianisierung auf. Runensteine und Schmuckanhänger dienten demnach als klares Glaubensbekenntnis.
Ein weiteres Zeichen der Verbreitung des Christentums ist die zunehmende Zahl der Dorfkirchen mit eigener Geistlichkeit.
Etablierung der Kirche im 12. Jahrhundert
Mit dem Annehmen des christlichen Glaubens verloren die schwedischen Könige ihre Position als religiöse Führer und ihre Funktion als Oberpriester. Eine Rolle, die nun die Kirche ausfüllte.
Während des 12. Jahrhunderts verstärkt sich die Organisation und Etablierung der Kirche.

Rund 500 Kirchen soll es zu Beginn des 12. Jahrhunderts gegeben haben, allein im Bistum Skara. Neben Skara werden in einem Verzeichnis um 1120 (das sogenannte Florenz-Dokument) Sigtuna, Linköping, Västerås und Tuna (Eskilstuna) als weitere Bischofssitze genannt.
Doch es gab auch noch Gamla Uppsala, als Zentrum des alten Glaubens ein Machtfaktor, dem ein christlicher König aber nicht mehr vorstehen konnte. Mit der Verlegung des Bistums Sigtuna nach Alt-Uppsala kam aber auch das Zentrum der „Heiden“ unter christliche Herrschaft.
Nachdem sich seit 1104 das Erzbistum Lund mit um die schwedischen Kirchen kümmerte, der Einfluss des Erzbistums Hamburg eingeschränkt wurde, erhielt das Königreich mit dem Aufstieg des Bistums Uppsala zum Erzbistum einen eigenen Erzbischof. Schweden war nun eine eigene Kirchenprovinz – ein Indiz für das Ende der Mission.
Der christliche Glaube hatte sich durchgesetzt und über die Jahrhunderte zu einer Stütze der Monarchie entwickelt.
Weitere Entwicklung
Zum Ende des 12. Jahrhunderts entstand die Kirchspieleinteilung (schwedisch: socken), die Kirche entwickelte sich zu einer gesamtschwedischen Institution. Mit der Stabilisierung der Kirche einher ging die Stabilisierung der Monarchie.
Im 13., auch noch 14. Jahrhundert zeichnet sich die Loslösung der Kirche vom Staat ab, kanonisches Recht soll gegen germanisches Rechtssystem durchgesetzt werden: Das betraf die Bischofswahl und Einsetzung der Priester durch die Kirche, nicht mehr durch Wahl der Bevölkerung. Aber auch Steuerbefreiung und der „Schutz“ vor weltlichem Recht sowie die Einführung des Zölibats.
Bei Verhandlungen zwischen dem Papstgesandten Wilhelm von Sabina und Reichsverweser Birger Jarl auf dem Kirchentreffen von Skänninge 1248 konnte sich die Kirche mit ihren Forderungen durchsetzen.
Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammen die ersten schriftlich festgehaltenen Landesgesetze, wie etwa das Upplandslagen und das Gutalagen. Hier finden sich ausdrückliche Verbote in Bezug auf „heidnische“ Riten, Stätten und Opfer – die christliche Lehre hat die alten Götter (noch) nicht gänzlich vertrieben.
Autor(in): Mathias Grohmann – [email protected]